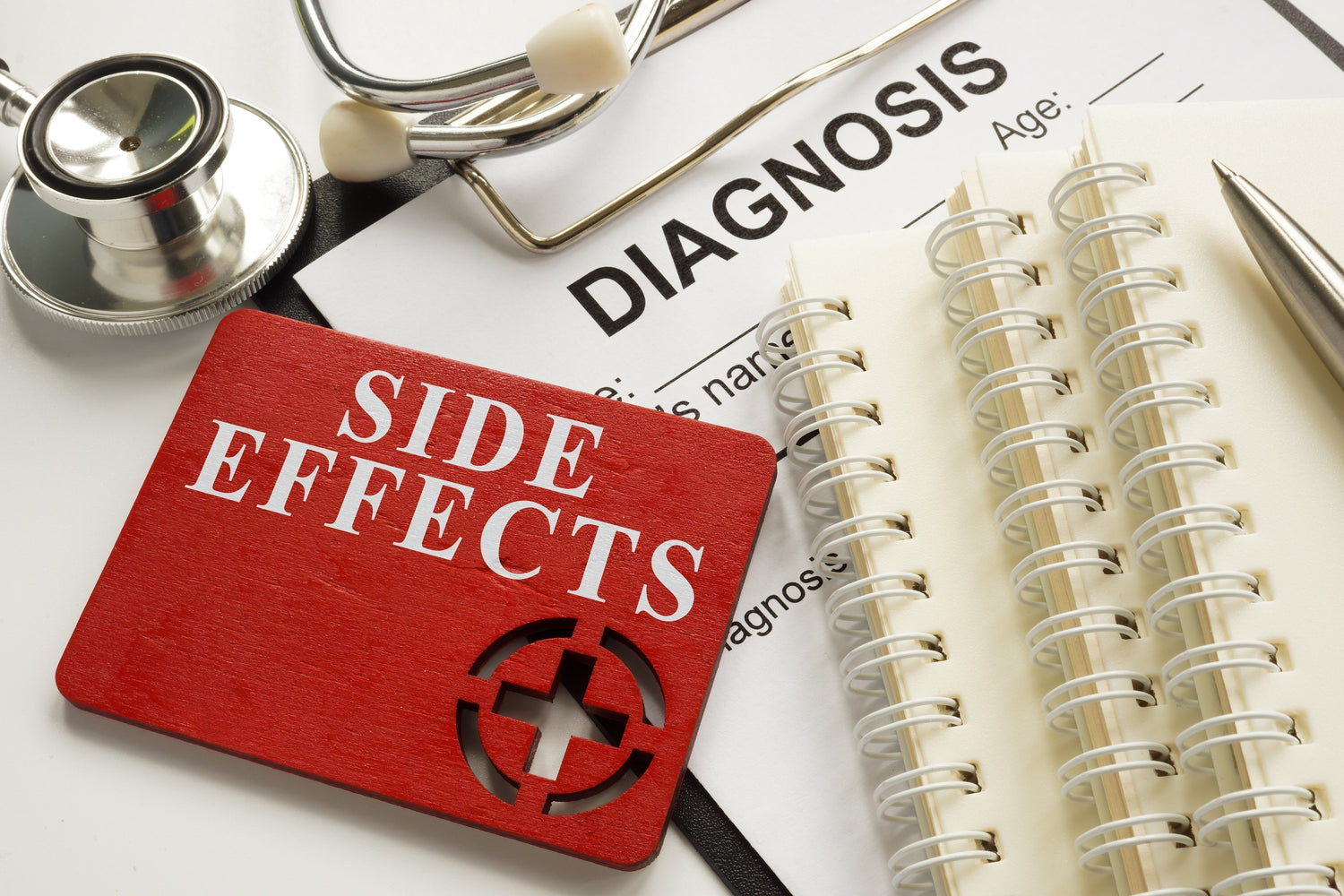Kurz gesagt: Cannabis kann entspannen, Schmerzen lindern und therapeutisch hilfreich sein – etwa bei chronischen Erkrankungen. Doch je nach Dosis, Person und Konsumform kann es auch unerwünschte Nebenwirkungen haben, wie Angst, Gedächtnisprobleme oder sogar psychoseähnliche Symptome. Entscheidend ist unter anderem, wie und wofür Cannabis verwendet wird: Denn medizinische Anwendungen zeigen deutlich weniger Risiken als der Freizeitkonsum.
Die Wirkung von Cannabis einfach erklärt
Cannabis wirkt, indem seine Inhaltsstoffe – vor allem THC – an bestimmte Rezeptoren im Körper andocken und dabei Prozesse im Gehirn und Nervensystem beeinflussen. Das kann entspannend, schmerzlindernd oder berauschend wirken, aber zum Beispiel auch Angst auslösen – je nach Dosis, Person und Situation.
Wer genauer wissen möchte, wie Cannabis im Körper wirkt, muss ein wenig tiefer ins Gehirn schauen. Dort nämlich entfaltet sich die eigentliche Cannabis-Wirkung – in einem biologischen Netzwerk, das lange unbekannt war: dem Endocannabinoid-System.
Dieses System regelt viele unserer körperlichen und geistigen Abläufe. Es hilft dabei, Emotionen auszugleichen, Schmerzen zu regulieren, Erinnerungen zu verarbeiten – und das Gehirn in Balance zu halten.
Was ist das Endocannabinoid-System?
Die Wissenschaft zeigt: Das Endocannabinoid-System (kurz: ECS) ist ein biologisches Netzwerk, das in fast allen Bereichen unseres Körpers vorkommt – besonders aber im Gehirn und im Nervensystem. Es ist kein isoliertes System wie etwa der Blutkreislauf, sondern ein fein vernetztes Steuerungssystem, das dabei hilft, unser inneres Gleichgewicht – die sogenannte Homöostase – aufrechtzuerhalten.
Das ECS erfüllt dabei eine modulierende Funktion: Es entscheidet nicht, ob ein Signal im Gehirn entsteht, sondern wie stark es ist, wie lange es anhält – und wann es wieder aufhören soll. Man könnte sagen: Während andere Botenstoffe im Gehirn auf das Gaspedal drücken, ist das ECS eher die intelligente Bremse, die Übertreibungen verhindert und den Informationsfluss im Gleichgewicht hält. Das ESC besteht aus drei Hauptkomponenten:
1. Endocannabinoide
Das sind körpereigene Botenstoffe, die in ihrer Struktur den Wirkstoffen der Cannabispflanze ähneln – daher der Name. Die beiden bekanntesten heißen Anandamid (benannt nach dem Sanskrit-Wort Ananda für Glück) und 2-AG. Diese Moleküle werden bei Bedarf produziert – etwa, wenn wir gestresst sind, Schmerzen haben oder das Gehirn überreizt ist.
Anders als viele klassische Botenstoffe (zum Beispiel Serotonin oder Dopamin) werden Endocannabinoide nicht auf Vorrat gespeichert, sondern „on demand“ gebildet: Sie entstehen direkt in der Zellmembran und wirken nur kurz und punktuell – wie eine Art feiner Pinselstrich im neuronalen Gleichgewicht.
2. Cannabinoid-Rezeptoren
Diese Rezeptoren sind Andockstellen auf der Oberfläche von Zellen, vor allem im Gehirn, aber auch in Organen wie Leber, Darm, Haut oder Immunsystem. Die beiden wichtigsten heißen CB1 und CB2:
- CB1-Rezeptoren sitzen hauptsächlich auf Nervenzellen im Gehirn und steuern dort die Kommunikation zwischen den Zellen – vor allem, indem sie Neurotransmitter wie GABA oder Glutamat drosseln.
- CB2-Rezeptoren kommen eher im Immunsystem vor und regulieren Entzündungsreaktionen. Bei bestimmten Krankheiten oder in Stresssituationen tauchen sie aber auch im Gehirn auf.
Diese Rezeptoren wirken wie Schalter im Körper: Werden sie aktiviert, lösen sie verschiedene Reaktionen aus – von Schmerzhemmung bis zur Stimmungsaufhellung.
3. Enzyme
Damit die Wirkung der Endocannabinoide nicht zu lange anhält, gibt es spezielle Enzyme, die sie nach getaner Arbeit wieder abbauen. Die wichtigsten heißen FAAH (für Anandamid) und MAGL (für 2-AG). Diese Enzyme wirken schnell und effizient – sie sorgen dafür, dass der Regelkreis des ECS präzise und zeitlich begrenzt funktioniert.
Wofür brauchen wir das ECS?
Das Endocannabinoid-System ist überall dort aktiv, wo es um Regulierung geht. Es spielt eine Rolle bei:
- der Schmerzverarbeitung
- dem Stressabbau
- der Appetitsteuerung
- der Gedächtnisbildung
- dem Schlaf
- und sogar beim Immunsystem.
Kurz gesagt: Das Endocannabinoid-System ist ein inneres Regulationsnetzwerk, das unser körperliches und seelisches Gleichgewicht unterstützt. Es arbeitet leise, präzise und ständig im Hintergrund – und genau deshalb kann sein Eingreifen durch Substanzen wie THC auch weitreichende Folgen haben.
Cannabis-Wirkung: Cannabinoide und andere Inhaltsstoffe
Cannabis ist weit mehr als nur THC: Die Pflanze enthält eine Vielzahl an Wirkstoffen, die auf unterschiedliche Weise im Körper wirken könnten. Neben den bekannten Cannabinoiden wie THC und CBD spielen auch andere Bestandteile wie Terpene eine Rolle – sie tragen nicht nur zum Duftprofil bei, sondern könnten die Wirkung von Cannabis gezielt verstärken oder verändern. Die sogenannte Cannabis-Wirkung entsteht also durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Substanzen – dem Entourage-Effekt.
Wirkungen und Nebenwirkungen von THC
THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol) wirkt hauptsächlich über die CB1-Rezeptoren im Gehirn und beeinflusst dadurch viele körperliche und psychische Prozesse. Es kann stimmungsaufhellend, schmerzlindernd oder beruhigend wirken – je nach Dosis, Konsumform und individueller Veranlagung. Doch die Wirkung von THC ist nicht immer harmlos: Besonders bei Jugendlichen oder Menschen mit psychischer Vorbelastung kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen. Die folgende Übersicht zeigt, welche Effekte THC laut Studien auslösen kann – und wo mögliche Risiken liegen.
Mögliche Wirkungen von THC
- Euphorie & Entspannung: THC kann kurzfristig die Stimmung heben, Angst reduzieren und ein Wohlgefühl auslösen.
- Schmerzlinderung: In bestimmten Fällen könnte THC helfen, chronische oder neuropathische Schmerzen zu lindern.
- Muskelentspannung: Besonders bei Muskelspastik (z. B. bei MS) zeigt THC eine leicht positive Wirkung.
- Appetitanregung & Übelkeitslinderung: Bei Chemotherapie oder Gewichtsverlust durch Krankheit könnte THC unterstützend wirken.
- Schlafverbesserung: Bei chronischen Schmerzen könnte THC den Schlaf fördern (wenn auch nur in geringem Maß).
- Antiemetisch (gegen Übelkeit): THC-haltige Präparate wie Dronabinol sind gegen chemotherapiebedingte Übelkeit zugelassen.
Mögliche kurzfristige Nebenwirkungen von THC
- Angst, Reizbarkeit, Paranoia
- Wahrnehmungsveränderungen: Halluzinationen, Depersonalisation, Wahnideen
- Kognitive Beeinträchtigungen: Gedächtnisstörungen, Konzentrationsprobleme, verlangsamtes Denken
- Motorische Koordinationsstörungen: erhöhtes Unfallrisiko beim Autofahren
- Herz-Kreislauf-Reaktionen: erhöhter Puls, Blutdruckschwankungen
- Übelkeit, Erbrechen – teils bei Überdosierung oder empfindlichen Personen
Diese Effekte treten v. a. bei hohen Dosen oder empfindlichen Personen auf, besonders bei hochpotenten THC-Produkten.
Mögliche langfristige Nebenwirkungen von THC:
- Erhöhtes Risiko für Psychosen und Schizophrenie – besonders bei frühem, häufigem und hochdosiertem Konsum.
- Depressionen und Angststörungen: häufigere Symptome bei regelmäßigen Konsumenten; erhöhtes Risiko für Rückfälle und schlechtere Behandlungsergebnisse.
- Motivationsverlust („Amotivationssyndrom“): Weniger Antrieb, soziale Isolation, Leistungsverlust.
- Suizidgedanken und -versuche: besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die häufig konsumieren.
- Lern- und Gedächtnisprobleme, vor allem beim regelmäßigen Konsum im Jugendalter.
- Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen (z. B. Planung, Problemlösung).
- Risiken für das Herz-Kreislauf-System: erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall.
- Atemwegserkrankungen: chronischer Husten, Bronchitis (v. a. beim Rauchen).
- Beeinträchtigung der Gehirnstruktur (z. B. kleinerer Hippocampus und Orbitofrontalkortex bei Dauerkonsumenten).
- Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit: Studien deuten darauf hin, dass Cannabis die Spermienanzahl und -qualität verringern kann. Wer eine Schwangerschaft plant, sollte auf den Konsum möglichst verzichten.
Wirkungen und Nebenwirkungen von CBD
Studien zeigen: CBD wirkt im Körper, indem es verschiedene Systeme beeinflusst – vor allem das sogenannte Endocannabinoid-System. Es bindet sich aber nicht direkt an die typischen Cannabis-Rezeptoren, sondern wirkt eher regulierend im Hintergrund. So könnte es beruhigend, entzündungshemmend, angstlösend oder schmerzlindernd wirken.
Mögliche Wirkungen von CBD
CBD hat in klinischen und präklinischen Studien vielversprechende Effekte gezeigt – vor allem bei:
- Epilepsie, insbesondere bei therapieresistenten Formen im Kindesalter (z. B. Dravet-Syndrom)
- Angststörungen und Panikattacken
- Psychosen (z. B. bei Schizophrenie)
- Chronischen Entzündungen und Schmerzen
- Neurodegenerativen Erkrankungen (z. B. Parkinson oder Alzheimer)
- Suchterkrankungen (z. B. Rückfallprävention bei Opiatabhängigkeit)
Auch bei Schlafstörungen und stressbedingten Beschwerden berichten viele Patient:innen über positive Effekte – diese sind wissenschaftlich aber noch nicht ausreichend belegt.
Mögliche Nebenwirkungen von CBD
CBD (Cannabidiol) gilt laut der aktuellen Studienlage als gut verträglich und sicher – selbst in hohen Dosen. Die meisten Menschen vertragen es ohne schwerwiegende Nebenwirkungen. Mögliche Nebenwirkungen, die in klinischen Studien beobachtet wurden, sind:
- Müdigkeit
- Durchfall
- Veränderter Appetit oder leichtes Gewichtsschwanken
Diese Nebenwirkungen traten vor allem bei sehr hohen Dosierungen oder in Kombination mit anderen Medikamenten auf.
Und wie wirken Terpene?
Terpene sind natürliche Duftstoffe, die in vielen Pflanzen vorkommen – auch in Cannabis. Doch sie sind mehr als nur Aromaträger: Terpene wie Linalool, Geraniol, α-Humulen oder β-Pinen haben nachweislich auch eine direkte Wirkung im Körper. Studien zeigen, dass sie an bestimmte Rezeptoren andocken können – etwa an die CB1-Rezeptoren, die auch durch THC aktiviert werden, oder an Adenosin-Rezeptoren, die Entspannung und Müdigkeit beeinflussen.
Terpene aus der Cannabispflanze – wie zum Beispiel Linalool, Geraniol, α-Humulen oder β-Pinen – könnten im Körper ähnliche Effekte wie Cannabis auslösen. In Tierversuchen zeigte sich:
- Sie könnten Schmerzen lindern,
- die Körpertemperatur leicht senken,
- für Ruhe oder Trägheit sorgen (man bewegt sich weniger),
- und in manchen Fällen auch eine Art Körperstarre auslösen (Katalepsie, wie bei sehr starker Muskelentspannung).
Außerdem konnten sie die Wirkung von Cannabinoiden verstärken – das nennt man Entourage-Effekt. Studien zeigten also: Terpene wirken nicht nur auf den Duft- oder Geschmackssinn, sondern haben selbst eine aktive, körperliche Wirkung.
Erfahre mehr in unserem Artikel zum Thema Cannabis-Terpene.
Medizinisches Cannabis: Nebenwirkungen einer Cannabis-Therapie
Cannabisarzneimittel werden in der Schmerztherapie und bei Symptomen wie Übelkeit, Appetitlosigkeit oder Spastik zunehmend eingesetzt – und gehen dabei häufig mit Nebenwirkungen einher. Das zeigt eine Auswertung von über 16.000 Datensätzen durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Müdigkeit zählt zu den am häufigsten berichteten Begleiterscheinungen, gefolgt von Schwindel, Übelkeit, Mundtrockenheit sowie kognitiven Beeinträchtigungen. Auch euphorische Zustände, Gewichtszunahme und gastrointestinale Beschwerden traten regelmäßig auf. In selteneren Fällen kam es zu Kreislaufproblemen, Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder suizidalen Gedanken.
Dennoch gehen die Autor:innen der Auswertung davon aus, dass die meisten Nebenwirkungen eher mild verlaufen – auch, weil sie nur selten zu einem Therapieabbruch führten. Interessant: Bei der Anwendung von Cannabisblüten wurden insgesamt weniger Nebenwirkungen gemeldet, was unter anderem mit dem geringeren Durchschnittsalter und möglicherweise größerer Vorerfahrung der Patient:innen erklärt wird. Das Sicherheitsprofil pflanzlicher Cannabisprodukte scheint damit ähnlich wie das zugelassener Fertigarzneien. Um belastbare Aussagen über deren Risiko-Nutzen-Verhältnis treffen zu können, seien jedoch weitere klinische Studien notwendig.
FAQ
Welche Auswirkungen hat Cannabis-Konsum auf den Körper?
Cannabis wirkt über das sogenannte Endocannabinoid-System und beeinflusst dabei viele Prozesse im Körper. Es könnte entspannen, Schmerzen lindern, die Stimmung heben oder den Appetit steigern. Kurzfristig könnte es aber auch zu Konzentrationsstörungen, Herzklopfen oder Angst kommen. Bei regelmäßigem Konsum sind Langzeitfolgen wie Antriebslosigkeit, Gedächtnisprobleme oder psychische Erkrankungen möglich. Besonders THC-haltige Produkte bergen ein Risiko für Nebenwirkungen.
Welche Nebenwirkungen kann Cannabis haben?
Cannabis kann kurzfristig Nebenwirkungen wie Angst, Paranoia, Schwindel, Konzentrationsprobleme, erhöhten Puls oder Übelkeit auslösen – vor allem bei hohen Dosen. Auch motorische Störungen wie Koordinationsprobleme sind möglich. Bei regelmäßigem Konsum drohen Langzeitfolgen wie Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen oder ein erhöhtes Risiko für Psychosen, vor allem bei jungen Menschen. Zudem kann sich eine psychische Abhängigkeit entwickeln. Die genaue Wirkung hängt von der Dosis, der Konsumform und der individuellen Veranlagung ab.
Kann Cannabis die Persönlichkeit verändern?
Chronischer Cannabiskonsum kann mit Veränderungen in der Persönlichkeit einhergehen. Studien zeigen, dass Konsumierende tendenziell offener für neue Erfahrungen sind, aber gleichzeitig weniger gewissenhaft und verträglich mit anderen Menschen. Zudem treten häufiger Persönlichkeitsmerkmale auf, die mit einer erhöhten Psychose-Anfälligkeit verbunden sind. Der medizinische Einsatz von Cannabis – z. B. bei chronischen Schmerzen oder MS – unterscheidet sich allerdings deutlich vom Freizeitkonsum. Eine große Metaanalyse mit über 210.000 Personen zeigt: Psychoseähnliche Nebenwirkungen treten bei medizinischer Anwendung deutlich seltener auf (1–2 %) als im Freizeitgebrauch (19–21 %). Gründe könnten die ärztliche Begleitung, standardisierte THC-Dosen oder der Zusatz von CBD sein, das antipsychotisch wirken kann.